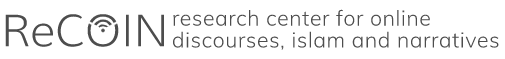In den vergangenen Jahren prägte wohl kaum ein anderes Phänomen die Sichtweisen auf Migration und Einwanderungsgesellschaft so sehr wie die scheinbar wachsende Bedrohung durch Islamismus. Spätestens seitdem sogenannte foreign fighters aus Deutschland im Nahen Osten kämpften und terroristische Angriffe in Berlin ebenso wie in anderen europäischen Großstädten Menschenleben forderten, stellte sich auch in Deutschland die Frage, wie derartige Gewalt verhindert werden könne.
In den vergangenen Jahren wurde so von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft versucht, das Wissen rund um die Themen Islamismus und Radikalisierungsverläufe zu erweitern sowie Präventionsprogramme zu initiieren, die derartigen Radikalisierungen bereits im Vorfeld entgegenwirken sollen. Allerdings hatten und haben sowohl Forschung als auch Praxis oft einen einseitigen Blick auf Islamismus und Islamismusprävention. Die in dem jüngst in der Zeitschrift „Gegen Vergessen – für Demokratie“ von Sindyan Qasem aufgeschriebenen Thesen und deren Erläuterungen sollen zweierlei erreichen: Erstens fassen sie den Status Quo der aktuellen Debatten um Islamismus und Islamismusprävention kurz und bündig zusammen. Zweitens regen sie an, bisher weniger beachtete Ansätze und Perspektiven in den Fokus zu nehmen.