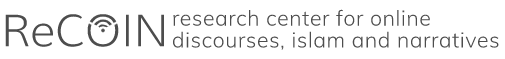Ein weiterer Zwischenbericht aus dem Projekt Countering Digital Dominance ist als CoRE-Report erschienen.
Marcel Klapp fragt in diesem Beitrag nach der Möglichkeiten einer Übertragung von diskurstheoretischen Konzeptualisierungen von Gegennarrativen als hegemoniale Ordnungsversuche in die Ebene sozialer Alltagserfahrung von sich als muslimisch identifizierenden Jugendlichen: Wie werden Diskurse in lokalen Settings und den verschiedenen sozialen Alltagswelten rezipiert, transformiert oder wie werden in Reaktion auf hegemoniale Diskurse lokale Gegenerzählungen produziert? Diese Fragen richten den Fokus weg von der Makroebene der Diskurse auf die möglichen Handlungsoptionen der Akteure und somit auf die Ebene sozialer Praxis, der sich Studie II des Forschungsprojektes widmet.
Was ist CoRE?
Das Hauptaugenmerk des Connecting Research on Extremism (CoRE) Nordrhein-Westfalen (NRW) Netzwerks liegt besonders auf dem Phänomen des extremistischen Salafismus und der Radikalisierung, aber schließt seit Kurzem auch die Forschung zu anderen Bereichen des politischen Extremismus ein. Etwas genauer heißt das, dieses Netzwerk hat erstens zum Ziel, die bestehende Expertise und Kompetenz aus Wissenschaft und Praxis für NRW nutzbar zu machen. Zweitens geht es darum, Forschungserkenntnisse zusammenzutragen, Wissenslücken zu identifizieren, Forschungsvorhaben anzustoßen und drittens, soll die Theorie-Praxis-Brücke innovativ erschlossen werden, damit alle von den Erkenntnissen innovativ profitieren.
Hierfür werden die Akteure vernetzt, bei denen sich die Wissenschaft, Politik sowie Praxisakteure austauschen. Für diesen Zweck werden die Kompetenzen so kombiniert, dass die Wissenschaft, Politik und der Praxisexperte miteinander agieren und voneinander profitieren. Das Ziel ist es, den Wissenschafts-Praxis-Transfer zu unterstützen und dadurch auch zu bestärken.
Das CoRE Netzwerk wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW.
Quelle: https://www.uni-bielefeld.de/zwe/ikg/institut/Publikationen.xml